To the Moon – Emotionen in 16 Bit
 Der 24 Jahre alte Kan „Reives“ Gao hatte nie vor, mit Spielen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Er hatte andere Pläne, Spieleentwicklung war nur ein Hobby. Er hätte genauso gut Kurzgeschichten schreiben, traurige Songs komponieren oder Filme drehen können, doch er mochte Videospiele. Also wählte er diese als Medium, um seine Geschichten zu erzählen. Er bastelte kleine Spiele, um sich der Welt mitzuteilen …auf die Gefahr hin, dass die Welt vielleicht nicht zuhörte.
Der 24 Jahre alte Kan „Reives“ Gao hatte nie vor, mit Spielen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Er hatte andere Pläne, Spieleentwicklung war nur ein Hobby. Er hätte genauso gut Kurzgeschichten schreiben, traurige Songs komponieren oder Filme drehen können, doch er mochte Videospiele. Also wählte er diese als Medium, um seine Geschichten zu erzählen. Er bastelte kleine Spiele, um sich der Welt mitzuteilen …auf die Gefahr hin, dass die Welt vielleicht nicht zuhörte.
Nein … Kan Gao hatte nie die Absicht in der Spielebranche Fuss zu fassen. Doch all dies änderte sich schlagartig, als die Welt mit einem Mal die Ohren spitzte, um ihm zu lauschen, und er mit einem kleinen Spiel namens „To the Moon“ bewies, dass grob aufgelöste Pixel auch heute noch zu Tränen rühren können.
Wirft man einen flüchtigen Blick auf „To the Moon“, werden Erinnerungen an die 1990er-Jahre geweckt, an in die glorreiche 16-Bit Ära, in der Super Nintendo und Mega Drive den Markt dominierten. Man sieht die vertraute Top-Down-Perspektive, suhlt sich in der eingeschränkten Farbpalette mit ihren 640 x 480 prächtigen Pixeln, liest geduldig zahlreiche Dialoge in Textboxen und fühlt sich direkt zu Hause. Lediglich die glasklare Klaviermusik erinnert einen daran, dass das Spiel nicht ganz so alt sein kann wie es aussieht.
SIND WIR NICHT ALLE EIN BISSCHEN RETRO?
Der Verdacht, dass „To the Moon“ eines der vielen Spiele ist, die auf der angesagten Retrowelle surfen, liegt da nahe. Aber ist dem wirklich so? Böse Zungen behaupten ja, dass Indie-Entwickler gerne mit dem Retrolook arbeiten, weil sie es einfach nicht besser können. Nicht selten tut man ihnen damit Unrecht. 8-Bit oder 16-Bit-Optik ist oft eine bewusste stilistische Entscheidung des Designers, sei es, um bei älteren Spielern wohlige Erinnerungen an unbeschwerte Kindheitstage zu wecken, um modernisierte Gamepaymechaniken alter Tage auch optisch zu unterstreichen oder weil es sich aufgrund des derzeitigen Trends wirtschaftlich rechnet.
Diese Faktoren waren bei der Entwicklung von „To the Moon“ jedoch vermutlich nicht ausschlaggebend. Kan Gao gibt offen zu, trotz Informatikstudiums kein sonderlich begabter Programmierer zu sein.
I’m still not much of a programmer. I’m more interested in the story and design aspects, I guess. A lot of the other folks in the industry I meet are so talented with programming. In that sense it feels like I’m in the circle but at an odd position. – Kan Gao in einem Interview auf eurogamer.net.
Daher verwendet er für die Produktion seiner Spiele den RPG-Maker von Enterbrain. Dieser reduziert zwar den Programmieraufwand auf ein Minimum, schränkt seine Nutzer gestalterisch jedoch auch stark ein. Mit dem RPG-Maker kann man Spiele zusammenklicken, die …nun ja … aussehen wie klassische Rollenspiele auf dem SNES. Das war es aber auch. Die Retrowelle dürfte Kan Gao bei seinen visuellen Entscheidungen demnach herzlich egal gewesen sein.
WAHRE MÄNNER MÖGEN PIXEL
Aber wer braucht schon Polygone, Antialiasing und Tessellation? Doch nur diese Grafikhuren, die wirklich gute Spiele gar nicht zu schätzen wissen. Ich möchte ehrlich sein: Im Grunde bin ich eine dieser Grafikhuren. Beim ersten Start von „To the Moon“ hatte ich zwar einen wohligen Nostalgieflash, war jedoch überzeugt, dass ich das Spiel nicht zu Ende spielen würde. Ich mag alten Käse zwar, aber ich mag ihn heute nicht mehr spielen. Die Steuerung war mir zu sperrig, die Grafik im Vollbildmodus viel zu verpixelt und auch noch verzerrt … neee … da winkte ich dankend ab.
Vier Spielstunden später saß ich an meinem Schreibtisch während der Abspann über den Monitor flimmerte. Ich verdrückte mir ein Tränchen. Was zum Teufel war das? Was habe ich da gerade erlebt? Hatte ich ernsthaft mehrfach eine Gänsehaut bei einem 16-Bit-Adventure? Wow.
Dem aufmerksamen Leser wird es vielleicht bereits aufgefallen sein: Eines meiner Lieblingsthemen ist „Das Videospiel als erzählendes Medium“. „To the Moon“ tritt wiederum den eindrucksvollen Beweis an, dass es keine fotorealistische Grafik braucht, um eine mitreißende Geschichte zu erzählen. Es tritt aber auch den Beweis an, dass ein Spiel wie ein Spiel aussehen kann, ohne wirklich eines zu sein. Ja … „To the Moon“ ist wieder eines dieser Spiele, in denen es nicht viel zu spielen gibt. Doch es spricht Themen an, die in anderen Spielen eher selten zur Sprache kommen: Was würde man machen, wenn man sein Leben korrigieren könnte? Wenn man bereits getroffene Entscheidungen rückgängig machen könnte? Und welche Preis wäre man bereit dafür zu bezahlen? Ach ja … ganz davon abgesehen geht es auch noch um den Umgang mit Krankheiten, um Verlust und um Trauer. Wuffa … harter Tobak, doch erstaunlich unprätentiös verpackt.
DIE GESCHICHTE EINES LEBENS
John Wyle hat seit dem Tod seiner Frau River nur einen Wunsch: er möchte zum Mond fliegen. Eine eher ungewöhnlicher Altersträumerei, deren Ursprung nicht einmal er selbst kennt. Sein Wunsch soll nicht unerfüllt bleiben. Das garantieren zumindest zwei Mitarbeiter der Sigmund Corporation: Doktor Eva Rosalene und Doktor Neil Watts.
„To the Moon“ spielt in einer nicht genauer definierten Zukunft, in der man dank einer Erfindung der Sigmund Corporation auf dem Todesbett sein Leben noch einmal komplett ändern kann … quasi. Das funktioniert wie folgt: Dank dieser Erfindung können die Mitarbeiter der Sigmund Corporation in die Erinnerungen von Menschen eindringen und diese verändern. Erinnerungen an falsch getroffene Entscheidungen werden gelöscht und durch neue ersetzt, in denen man all das erreicht hat, was man sich für sein Leben erträumt hat. Dies gelingt jedoch nur dann, wenn der jeweilige Kunde bereits im Sterben liegt. Wäre dies nicht der Fall würden die nachträglich eingepflanzten Erinnerungen mit den tatsächlich erlebten im Konflikt stehen. Sollte der Kunde dann erwachen, würde dieser Konflikt zu einer kognitiven Dissonanz führen und das wäre wiederum gar nicht gut. Klare Sache.
Als die beiden Doktoren in Johns ungewöhnlichem Haus, hoch oben auf steilen Klippen in unmittelbarer Nähe zu einem verlassenen Leuchtturm, ankommen, liegt dieser bereits in einem künstlichen Koma und wird von seiner Ärtzin am Leben gehalten. Nach einem kurzen Gespräch mit seiner Haushälterin Lily und einer Führung durch das Haus, machen sich Dr. Rosalene und Dr. Watts direkt ans Werk. Ihre Reise durch Johns Erinnerungen findet in umgekehrter Chronologie statt. Der Startpunkt der beiden Doktoren sind relativ frische Erlebnissen, auf die sie recht einfach Zugriff erhalten. Erst nach und nach arbeiten sie sich bis in seine Jugend vor, immer auf der Suche nach dem Schlüsselpunkt, an dem sie ansetzen können, um Johns Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Sogenannte Memorylinks weisen ihnen hierbei den Weg zur jeweils nächsten Erinnerung. Die Suche nach diesen Links und deren Aktivierung (mit Hilfe kleiner Schiebepuzzles) stellen zugleich einen großen Teil des eigentlichen Gameplays dar. Die meiste Zeit über sitzt man jedoch mehr oder weniger untätig da und folgt der Geschichte.
Diese dreht sich zu großen Teilen um Johns Beziehung zu seiner Frau River, mit der er schon in jungen Jahren zusammen gekommen ist. Gemeinsam durchlebten die Beiden gute und weniger gute Zeiten, hielten sich jedoch bis ins hohe Alter die Treue. Doch auch die liebevollen Erinnerungen an Johns Frau geben den beiden Doktoren keinen Hinweis darauf, wieso dieser überhaupt auf den Mond möchte. In seiner frühen Kindheit stoßen sie dann schließlich auf ein schwarzes Loch, eine Erinnerung, auf die sie nicht zugreifen können. Was verbirgt sich hinter dieser Blockade des Vergessens? Werden Dr. Rosalene und Dr. Watts herausfinden, weshalb John unbedingt die Mondoberfläche betreten möchte? Und was haben all die rätselhaften Origamihasen zu bedeuten, die River im Laufe der Jahre gebastelt hat?
Ja … all das würde ich am liebsten hier an dieser Stelle verraten, denn „To the Moon“ hat eine wirklich herzerwärmende und erzählenswerte Geschichte. Und ich würde sie jetzt gerne komplett niederschreiben und dann würde ich gerne behaupten, dass sie von mir ist, und dann würde ich sie vielleicht auch noch verfilmen und dann würden mich alle bewundern. Ach ja …
DIE SACHE MIT DER IMMERSION
Apropos Film … in der Tat könnte man aus der Geschichte einen bezaubernden kleinen Film basteln und Kan Gao wurde bereits des Öfteren gefragt, warum er die Story denn unbedingt in Form eines Spieles erzählen wollte. Vor allem in Form eines Spieles, in dem es nicht viel zu spielen gibt. Seine Antwort darauf lautet wie folgt:
Interaction is one of those things that on an unconscious level is somewhat underestimated. Even just being able to walk around in a world adds a lot to the sense of involvement over time. – Kan Gao in einem Interview auf eurogamer.net.
Damit spricht Kan Gao einen Punkt an, den ich bereits in meinen „Gone Home“-Artikel vorgebracht habe. Interaktivität, und sei diese noch so banal, erhöht die Immersion. Durch die (streng genommen vorgetäuschte) aktive Beteiligung an der Handlung ist die emotionale Bindung an das Geschehen stärker. „To the Moon“ belegt diese Theorie sogar noch ein wenig besser wie „Gone Home“. Es ist nicht die Präsentation, die den Spieler mit Schauwerten blendet und durch eine emotionale Inszenierung und schöne Grafiken an die Figuren bindet, „To the Moon“ ist visuell so minimalistisch, dass man zu großen Teilen die Interaktion und die Geschichte dafür zur Verantwortung ziehen kann, dass man an dem Schicksal der Figuren interessiert ist. Zugegeben … die melancholische Musik (ebenfalls von Kan Gao) trägt ebenfalls ihren guten Teil dazu bei.
Uffz … so viele Worte für so ein kleines Spiel. Dabei bin ich noch nicht einmal ein begeisterter Fan von Indie-Spielen, da diese sich meines Erachtens viel zu oft auf einer einzigen guten Idee ausruhen und ansonsten auf Dauer nicht viel zu bieten haben. Aber für diese avantgardistisches Kunstkacke, für Spiele, die man nur mit viel guten Willen „Spiel“ nennen kann, … dafür habe ich offenbar ein Faible. Furchtbar. Da kann ich mich ja gleich mit einem Glas Bordeaux vor den Kamin setzen und über die existenzialistische Bedeutung der Fettskulpturen von Joseph Beuys philosophieren, während im Hintergrund einer dieser (größtenteil) unerträglichen Lars von Trier Filme läuft. Kunst um der Kunst willen. Bah.
INDIES FTW (?)
Doch ich kann mir nicht helfen, ich mag einfach gut erzählte Geschichten und ich mag es, wenn Spieleentwickler ausloten, auf welche Art und Weise man diese in Videospielen präsentieren kann. Den größten Mut hierbei beweisen wiederum Indie-Entwickler. Davor ziehe ich meinen imaginären Hut. Es ist prinzipiell nur schwer vorstellbar, dass große Publisher wie Activision-Blizzard, EA oder Ubisoft Geld und Arbeitskraft in solch kleine und persönliche Geschichten stecken würde. Ein vergleichsweise intimes Werk wie „To the Moon“ kann im Umfeld eines Multimillionen-Dollar-Unternehmens nicht entstehen. Nachdem es durch die Mühlen der Marktforschung, der Fokusgruppentests und des Marketings gegangen wäre, käme am anderen Ende ein Werk mit schickeren Grafiken, mehr Explosionen und deutlich weniger Persönlichkeit heraus. Das ist nun mal so, ist zugleich aber auch nicht wirklich schlimm. Ein großes Unternehmen kann sein Zielpublikum nicht ignorieren und muss dessen Wünsche befriedigen. Kan Gao wusste wiederum nicht einmal, dass es ein Zielpublikum gab als er mit der Arbeit an „To the Moon“ begann:
I don’t think I actually tried to think of the audience first. I was selfish in that regard, I pretty much made what I wanted to make. I was trying to turn a lot of unfortunate events in my life at that point into something more productive so I would look back and they wouldn’t have been in vain. – Kan Gao in einem Interview auf eurogamer.net.
Für eine so persönliche und intime Herangehensweise braucht es einfach die Indies. Da braucht es Einzelpersonen, die Spiele machen UND Geschichten erzählen wollen. Personen, die der Welt etwas mitteilen wollen. Genau das braucht es und genau das kann ganz, ganz furchtbar in die Hose gehen. Doch manchmal … manchmal kann das auch zu kleinen Diamanten führen.
Abschließend bleibt mir nur noch eines zu sagen: Ich freue mich echt wahnsinnig auf „Infamous – Second Son“. Hähähä … mit einem RUMMS werde ich dank meiner pervers schicken Superkräfte die gesamte Stadt in Schutt und Asche legen. In 1080p und Partikeleffekten bis zum Abwinken. KABOOOM! Das wird schön.
Es muss Beides geben …
_______________________
„To the Moon“ gibt es auf Steam, bei Good Old Games oder auf der Seite von Kan Gao für 7,99 € bzw. 9,99 $. „Infamous – Second Son“ kann man wiederum bei Amazon vorbestellen.



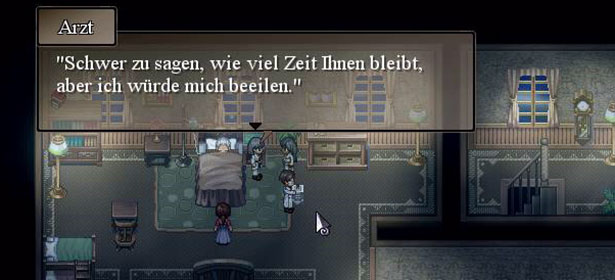



Ein Kommentar
Pingback: